Joe öffnete den Kühlschrank und warf einen Blick auf dessen kärgliches Innenleben. Er griff nach einem Karton Orangensaft und setzte ihn an den Mund. In zwei Stunden, da war er sich sicher, würde er wieder pissen müssen. Vielleicht sollte er sich die Prostata untersuchen lassen. Immerhin ließen viele Männer in seinem Alter das machen. Aber den Gedanken, sich von einem fremden Mann einen Finger in den Arsch stecken zu lassen, fand Joe nicht besonders prickelnd.
Er stellte den Saftkarton zurück, schloss die Kühlschranktür und drehte sich um und – bam – da war sie. Sie riss ihren Mund so weit auf, dass ihren Zügen alles Menschliche abhandenkam. Dabei entblößte sie eine Reihe verfaulender Zähne. Es war wie ein stummer Schrei. Joe blickte sie nur unverwandt an. Starrte in ihre seelenlosen Augen, auf ihre graue, verwesende Haut und auf die breiten Striemen an ihrem Hals. Dann rieb er sich die Augen, seufzte wieder und fragte in einem müden Tonfall: „Echt jetzt? Hat man nicht mal mehr beim Pissen seine Ruhe?“ Sie neigte den Kopf und blickte ihn verwirrt an. Dabei gewannen ihre Züge fast wieder ein wenig von dem Menschen zurück, der sie einmal gewesen war. Doch Joe wusste, dass nichts Menschliches mehr in dieser Erscheinung steckte, schon lange nicht mehr. Ein letztes Mal entblößte sie ihre schwarzen Zähne und verzog ihr Gesicht zu einer Grimasse, die entfernt an ein menschliches Lächeln erinnerte. Dann verschwand sie in die Dunkelheit die sie genauso unvermittelt verschluckte, wie sie sie ausgespuckt hatte. Joe schüttelte den Kopf, legte sich hin und schlief – zu seiner Überraschung – die restliche Nacht durch. Zorn Der Weg zur Arbeit war die übliche Quälerei. Die Straßen waren bereits früh morgens verstopft und Joe stand mit seinem alten Honda Civic in einem kilometerlangen Stau, die Stereoanlage voll aufgedreht. Es lief – wie immer – Faith no More King for a Day, Fool for a Lifetime in Endlosschleife. Ein Freund hatte ihm das Album irgendwann zum Geburtstag geschenkt. Es war kein besonders guter Freund gewesen – Freunde gab es in Joes Leben generell nicht sehr viele. Ein besserer Freund hätte jedoch gewusst, dass Joe amerikanische Rockmusik eigentlich nicht mochte und eine solche Platte daher ein recht riskantes Geschenk war. Joe hasste grundsätzlich alles, was aus Amerika kam, inklusive seines Vaters - ein amerikanischer GI, der Joe und seine Mutter hatte sitzen lassen, als Joe gerade mal zwei Jahre alt gewesen war. Der Krieg war zu diesem Zeitpunkt schon einige Jahre vorbei und die USA hatten ihren Job erledigt. Und wie sie das hatten. Joe hatte seinen Vater nie richtig kennengelernt, aber ginge es nach ihm, hätte er genauso gut der Drecksack sein können, der die Bombe über Nagasaki abgeworfen hatte. Die Bombe, die Joes Großeltern getötet hatte. Der beschissene Höhepunkt eines durch und durch beschissenen Krieges. Im Vergleich zu seiner Mutter, hatten seine Großeltern aber noch Glück gehabt. Bei ihnen ging es wenigstens schnell. Als er neunzehn war, erkrankte Joes Mutter an Lungenkrebs – vielleicht hervorgerufen durch den radioaktiven Fallout, den amerikanischen Fallout, vielleicht auch nicht. Die Ärzte konnten jedenfalls nichts für sie tun. Joe sah ihr achtzehn Monate dabei zu, wie sie starb, jeden Tag ein Stück mehr. Damals hatte Joe das Wesen des Todes begriffen. Es lag nichts Heldenhaftes darin, nichts Edles oder Mystisches. Es war einfach nur sinnlos, traurig und endgültig. Er warf einen Blick in den Rückspiegel und einen Augenblick lang hatte er das Gefühl sein Spiegelbild würde sich über ihn lustig machen, als wollte es sagen: „Scheiße, bist du alt geworden.“ Er änderte die Neigung des Spiegels und betrachtete das Mädchen auf dem Rücksitz. Ihre Haut war blass, beinahe durchsichtig. Traurig starrte sie aus dem Fenster auf eine Welt, die für sie schon lange nicht mehr existierte. Ihre Hände mit den aufgeschlitzten Handgelenken hatte sie artig in den Schoß gelegt. So saß sie schon die ganze Fahrt über da. Als Joe jedoch auf den Parkplatz einbog und seinen Wagen neben einem verdreckten Nissan abstellte, der schon seit Wochen dort stand und dessen Besitzer wahrscheinlich niemals wieder auftauchen würde, war das Mädchen plötzlich verschwunden. Doch sie würde wieder kommen. Sie kamen alle wieder. Joe musste an eine Passage aus Hamlet denken: O Gott, ich könnte in eine Nussschale eingesperrt sein und mich für einen König von unermesslichem Gebiete halten, wenn nur meine bösen Träume nicht wären. Joe konnte mit Shakespeare eigentlich nicht viel anfangen – der war zwar kein Amerikaner, aber Engländer, was ja im Grunde dasselbe war – jedoch hatte er Hamlet immer schon gemocht und diese Zeile schien ihm passend. „Wahnsinn“, dachte er, „Wahnsinn in einer Nussschale, das ist es, was hier vor sich geht.“ Verhandeln Joe schnappte sich seinen Rucksack aus dem Kofferraum, zog sich seine grüne Regenjacke über und machte sich auf den Weg in den Wald. Das war sein Job. Er war Aufseher im Aokigahara. Doch das beschrieb nicht annähernd was er dort wirklich tat. Aokigahara ist ein über 3.000 Hektar großes Waldgebiet am Fuße des Fuji. Es führt nur ein Wanderweg quer durch das Gebiet, ein Weg auf dem man in den Wald hinein und wieder heraus kommt. Das würde einen Aufseher grundsätzlich überflüssig machen, doch abseits des Weges verliert man leicht die Orientierung. Hier bewahrt der Wald seine dunklen Geheimnisse. Viele haben den sicheren Weg verlassen und nur wenige haben wieder zurück gefunden. Die meisten kamen nie wieder und manche wollten das auch nicht. Im Volksmund wird Aokigahara „Selbstmordwald“ genannt. Es ist laut dem Schriftsteller Seicho Matsumoto der Ort, an dem man alles beenden kann. Wie viele im Laufe der Jahre dort Allem ein Ende setzten ist nicht sicher, aber es müssen Tausende gewesen sein. Joe alleine hatte in seinen siebenzehn Jahren als Aufseher über hundert Leichen entdeckt. „Es waren bestimmt über hundert, ganz sicher“, murmelte er vor sich hin, während er den Weg verließ und seine Füße auf den moosigen Waldboden setzte. Das war Joes Job. Er unterstand der Präfektur Yamanashi und patrouillierte im Selbstmordwald auf der Suche nach Verzweifelten und Lebensmüden, die er von ihren Plänen abhalten sollte. Doch meistens fand er nur die Leichen der Menschen, denen zu helfen eigentlich seine Aufgabe gewesen wäre. Dann verfolgten ihre aufgedunsenen, verfaulenden Gesichter und ihre verstümmelten Körper ihn in seinen Träumen. Ja, meistens kam Joe zu spät. „Außer dieses eine Mal“, dachte Joe, „dieses eine Mal warst du rechtzeitig und konntest tatsächlich jemanden retten.“ Nach eineinhalb Stunden begann es zu nieseln. Ihm blieb nicht mehr viel Zeit, dann müsste er umkehren, sonst würde er es vor der Dunkelheit nicht mehr zum Parkplatz zurück schaffen. Er blickte sich um und überlegte in welche Richtung er weiter gehen sollte, da fiel sein Blick auf etwas Gelbes, das sich etwa zwanzig Meter von ihm entfernt von den Braun- und Grüntönen der Umgebung abhob. Auch aus dieser Entfernung wusste Joe ganz genau, was es war. Es war eine neongelbe Nylonschnur, die um den Stamm eines Baumes gebunden war. Selbstmörder verwendeten Schnüre wie diese, in leuchtenden, grellen Farben, damit ihre Leichen später von den Behörden gefunden werden konnten. Joe folgte der Schnur. Von Baumstamm zu Baumstamm, Meter für Meter bis er zu einem ausgetrockneten Flussbett kam. Dort fand er die Leiche einer jungen Frau, soviel zumindest konnte er anhand der Kleidung und der roten Schleifen in ihrem Haar erkennen. Ansonsten hatte diese Gestalt nichts mehr mit der Frau gemein, die sie einmal gewesen war. Die Haut war schwarzblau verfärbt. Der Körper wies bereits deutliche Spuren von Verwesung auf. Wahrscheinlich lag sie schon seit ein paar Wochen hier. Rock und Weste schienen zu einer Schuluniform zu gehören. Wie alt mochte sie wohl gewesen sein? Fünfzehn? Sechzehn, wenn es hoch kam? Was für eine Verschwendung. Joe zwang sich hinzusehen, jedem natürlichen Impuls in seinem Körper zum Trotz, der ihm befahl seinen Blick abzuwenden. Zumindest das, dachte er, wäre er dem Mädchen schuldig, dass er jetzt hinsah, auch wenn es zu spät war, dass er ihr jetzt zumindest die Aufmerksamkeit schenkte, die zu schenken ihre Mitmenschen verabsäumt hatten, als sie noch lebte. Kein Messer. Kein Seil. Vielleicht Schlaftabletten. Er zog sein Handy aus der Tasche und wählte die Nummer des Polizeinotrufs. Während er die GPS-Koordinaten des Fundortes durchgab sah er auf der anderen Seite des Flussbettes, auf einer Anhöhe ein Mädchen in Schuluniform und mit roten Schleifen in den Haaren. „Tut mir leid“, flüsterte er und senkte seinen Blick. Depression Als Joe nach Hause kam, war es bereits seit mehreren Stunden dunkel. Er warf seine Jacke und seinen Rucksack auf den Küchentisch und schenkte sich einen vierfachen Gin ein, den er ohne Eis in einem Zug runterkippte. Er wartete bis das Brennen in seiner Kehle nachließ und der Alkohol seinen Magen wärmte, dann schenkte er sich nach. Denn eines wusste Joe, nämlich, dass schlechte Erinnerungen verdammt gute Schwimmer waren. Er legte sich auf die Couch und stellte den Fernseher an. Es liefen Nachrichten, doch Joe war zu müde, als dass er ihnen hätte folgen können. Als ihn schließlich das laute Klopfen weckte, war es schon früh am Morgen. Joe hatte die ganze Nacht halb sitzend auf der Couch geschlafen. Sein Rücken tat ihm weh und sein Kopf ebenfalls. Leise verfluchte Joe denjenigen, dem es einfiel ihn um diese Zeit zu wecken. Vor der Tür standen zwei Anzüge. Sie zeigten ihre Marken und nannten ihre Namen, doch die hatte Joe sofort wieder vergessen. Alles an diesen Typen schrie „BULLEN“. Zwar arbeitete Joe für eine Behörde, aber für die Polizei hatte er noch nie viel übrig gehabt, schon gar nicht, wenn sie früh morgens unangekündigt vor seiner Tür stand. „Kennen Sie jemanden namens Kenji Sakura?“, fragte der blaue Anzug. „Ist er tot?“ „Warum fragen Sie?“ „Nur so.“ „Wann haben Sie Herrn Sakura das letzte Mal gesehen?“, fragte der schwarze Anzug. „Ist schon eine Weile her, aber wollen Sie mir vielleicht verraten, worum es eigentlich geht?“ „Kenji Sakura arbeitete die letzten fünf Jahre als Pfleger in einem Altersheim“, sagte der schwarze Anzug. „Irgendwann hat die Heimleitung Unregelmäßigkeiten festgestellt“, ergänzte der blaue Anzug. „Während seiner Schicht sind mehr Patienten verstorben als bei jedem anderen Pfleger.“ „Und?“ „Herr Nakamura, Kenji Sakura befindet sich im Moment in Untersuchungshaft. Ihm werden mindestens sieben Morde zur Last gelegt.“ „Was hat das Ganze mit mir zu tun?“, fragte Joe, dem der Kopf schmerzte und der sich am liebsten ins Bett gelegt hätte. „Das wüssten wir auch gerne. Jedenfalls hat Sakura darauf bestanden, dass er nur mit Ihnen darüber sprechen will.“ Der Verhörraum roch nach Schweiß und Verzweiflung. Es gab keine Fenster, deshalb leuchteten auch jetzt mitten am Tag die grellen Neonröhren. Joe trank lauwarmen Kaffee aus einem Styroporbecher und starrte auf den kotzgrünen Linoleumboden, während er darauf wartete, dass sie Kenji holten. Der kleine Kenji Sakura. Wie lange war das jetzt her? Fünfzehn Jahre? Joe kam es vor, als wäre es letzte Woche gewesen, dass er das dreckige Zelt im Aokigahara gefunden hatte. Darin war ein Junge, ein Ausreißer, gerade mal dreizehn Jahre alt. Er hatte ein paar Süßigkeiten, einen Sixpack Bier und eine große Packung Schlaftabletten bei sich. Joe wusste augenblicklich, was der Junge vorhatte. Er begann mit ihm zu sprechen – ruhig und behutsam - bis der Junge zögerlich antwortete. Er erzählte Joe vom Tod seiner Eltern, von seinen Pflegeeltern, die ihn vernachlässigten und misshandelten, von den Problemen in der Schule und den Hänseleien seiner Mitschüler. Joe benötigte eineinhalb Tage bis ihm der Junge die Tabletten aushändigte und einen weiteren Tag, bis er bereit war mit Joe den Wald zu verlassen. Danach kümmerte sich Joe um ihn. Er sorgte dafür, dass er zu neuen Pflegeeltern kam und auf eine neue Schule gehen konnte. Mit der Zeit ging es dem Jungen besser. Er machte seinen Abschluss und begann eine Ausbildung als Krankenpfleger. Seit damals hatte ihn Joe nicht mehr gesehen. Die Tür ging auf und zwei Uniformen führten Kenji Sakura ins Verhörzimmer. Sie setzten ihn Joe gegenüber auf einen Stuhl und fixierten seine Hände mit Handschellen an der Stuhllehne. Dann gingen sie wieder. Joe schaute Kenji an. Er hatte sich verändert, war älter geworden, hatte sogar einen Bart. Doch in seinen Augen erkannte er immer noch den kleinen Jungen von früher. „Danke, dass du gekommen bist“, sagte Kenji mit leiser Stimme und senkte seinen Blick. „Vielleicht kannst du mir auch verraten, was ich hier soll.“ „Ich wollte, dass du es von mir erfährst.“ „Was erfahren?“ „Was wirklich passiert ist.“ „Also hast du es getan?“ „Nicht so, wie sie es behaupten.“ Dann erzählte Kenji die ganze Geschichte. Er berichtete von den alten Menschen, den Todkranken, ihren Schmerzen und wie sie in den Heimen dahinvegetierten, verlassen und leidend. Unweigerlich musste Joe dabei an seine Mutter denken. Kenji erzählte, wie einige seiner Patienten ihn täglich angefleht hatten, sie zu erlösen. Erst hatte er sich geweigert. Natürlich hatte er sich geweigert. Er hatte ihnen nicht einmal zuhören wollen, doch mit der Zeit hatte er ihr Flehen nicht länger ausblenden können, hatte den Anblick der Schläuche und Maschinen nicht mehr ertragen können. Er hatte sich schuldig gefühlt, hatte sich verantwortlich gefühlt. Und dann hatte er es getan. „Warum erzählst du mir das alles?“, fragte Joe nach einiger Zeit. „Ich…ich weiß auch nicht. Du hast so viel für mich getan und ich wollte nicht, dass du schlecht von mir denkst. Ich wollte dass du verstehst, dass ich nie jemandem schaden wollte.“ Kenji begann zu weinen und der kleine Junge drängte sich Joe wieder ins Gedächtnis. „Ich bin kein Mörder“, flehte er. „Doch, Kenji, genau das bist du“, erwiderte Joe. Die Enttäuschung und Erschütterung über die Tat seines Freundes gewann die Oberhand. „Du hattest kein Recht das zu tun. Egal wie aussichtslos die Situation dieser Menschen auch war, es war nicht an dir, diese Entscheidung zu treffen. Gerade du hättest es besser wissen müssen. Es gibt immer einen Ausweg.“ „Vielleicht hatte ich nicht das Recht, aber ich hatte die Pflicht. Ich musste doch etwas unternehmen. Ich musste ihnen doch helfen.“ „Was soll das denn für einen Hilfe sein“, schrie Joe und stand auf. Er konnte sich nicht mehr länger beherrschen, konnte hier nicht weiter in aller Seelenruhe sitzen und über den Tod von so vielen Menschen sprechen. „Wie kannst du es auch nur wagen, das, was du getan hast, Hilfe zu nennen. Du hast diesen Menschen alles genommen.“ Joe ging zur Tür. Bevor er klopfte um rausgelassen zu werden, atmete er noch einmal tief durch, drehte sich um und sagte: „Ich wünsche dir alles Gute, Kenji.“ Akzeptanz Am ersten Tag der Verhandlung saß Joe im Gerichtssaal. Eigentlich hatte er nicht kommen wollen. Er hatte vom Prozess nichts wissen wollen, doch als es soweit war, konnte er nicht anders. Er musste einfach mit eigenen Augen sehen, wie es Kenji erging. Es wurde eine Hexenjagd. Die Staatsanwaltschaft setzte alles daran, Kenji als gestörten, gewaltbereiten Soziopathen darzustellen, der schon als Jugendlicher Probleme mit seinen Zieheltern und seinen Mitschülern hatte. Auch die Geschichte mit seinem Selbstmordversuch gruben sie wieder aus und die Aasgeier von der Presse stürzten sich darauf wie auf einen verfaulenden Kadaver. Joe wusste schon am ersten Tag, wie das Ganze enden würde. Sie würden Kenji bis an sein Lebensende in eine psychiatrische Anstalt stecken, wo man ihm eine Zwangsjacke anlegen und ihn mit Psychopharmaka vollpumpen würde, während man seinen Verstand mit Elektroschocks grillte. Man würde ihn einfach für verrückt erklären. Doch wenn Kenji eines nicht war, dann war das ein Verrückter. In Joe wuchs der Wunsch Kenji zu helfen, dem kleinen Jungen von damals ein letztes Mal zur Seite zu stehen. Doch was konnte er schon groß tun? Die Wochen vergingen und das Gefühl der Hilflosigkeit nagte an Joe. Doch dann hatte er eine Idee und nachdem sich der Gedanke erst einmal in seinem Kopf festgesetzt hatte, gab es für ihn kein Zurück mehr. Am Tag der Urteilsverkündung nahm Joe ganz hinten im Saal, direkt neben dem Ausgang Platz. Das Interesse am Prozess hatte spürbar nachgelassen und die Zeitungen trieben wahrscheinlich gerade irgendeine andere, arme Sau durchs Dorf. Daher waren nur wenige Leute im Gerichtssaal. Der Richter tat, was von ihm erwartet wurde und verurteilte Kenji zu lebenslanger Haft in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Kenji nahm das Urteil regungslos zur Kenntnis. Dann wurde er von zwei Vollzugsbeamten aus dem Saal geführt. Joe stand auf und als Kenji an ihm vorbei kam, machte er einen Schritt auf ihn zu und in einer flüssigen Bewegung streckte er ihm die Hand entgegen. Bevor die Beamten reagieren konnten, ergriff Kenji die Hand und drückte sie. Er blickte in Joes Augen und sah, dass dieser verstand. Dann wurde Kenji aus dem Saal geschoben. Auf dem Weg nach Hause ließ Joe den ganzen Tag nochmals Revue passieren: das kleine Stück, das er von der Rasierklinge abgebrochen hatte – nicht größer als ein Fingernagel - das er dann mit Klebeband umwickelt und das er Kenji im Gerichtssaal unbemerkt in die Hand gedrückt hatte. Ein kleines Stück Stahl, das Kenji eine Wahl ermöglichte. Als Joe in seine Wohnung kam, war es bereits dunkel. Er griff sich eine Flasche Gin und setzte sich an den Küchentisch. Einige Minuten lang betrachtete er die farblose Flüssigkeit in der Flasche. Sie versprach Ruhe, Frieden und Vergessen. Als Joe aufblickte sah er Kenji, der ihm gegenüber am Tisch saß und lächelte.
2 Comments
Leave a Reply. |
Categories
All
Archives
October 2019
Mehr Texte finden Sie unter www.mitgiftler.at
|
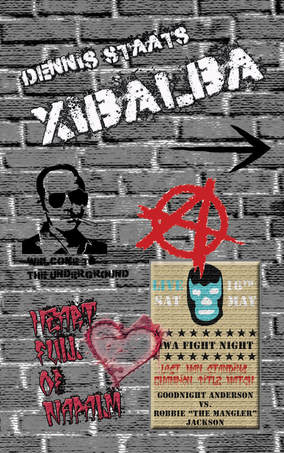
 RSS Feed
RSS Feed